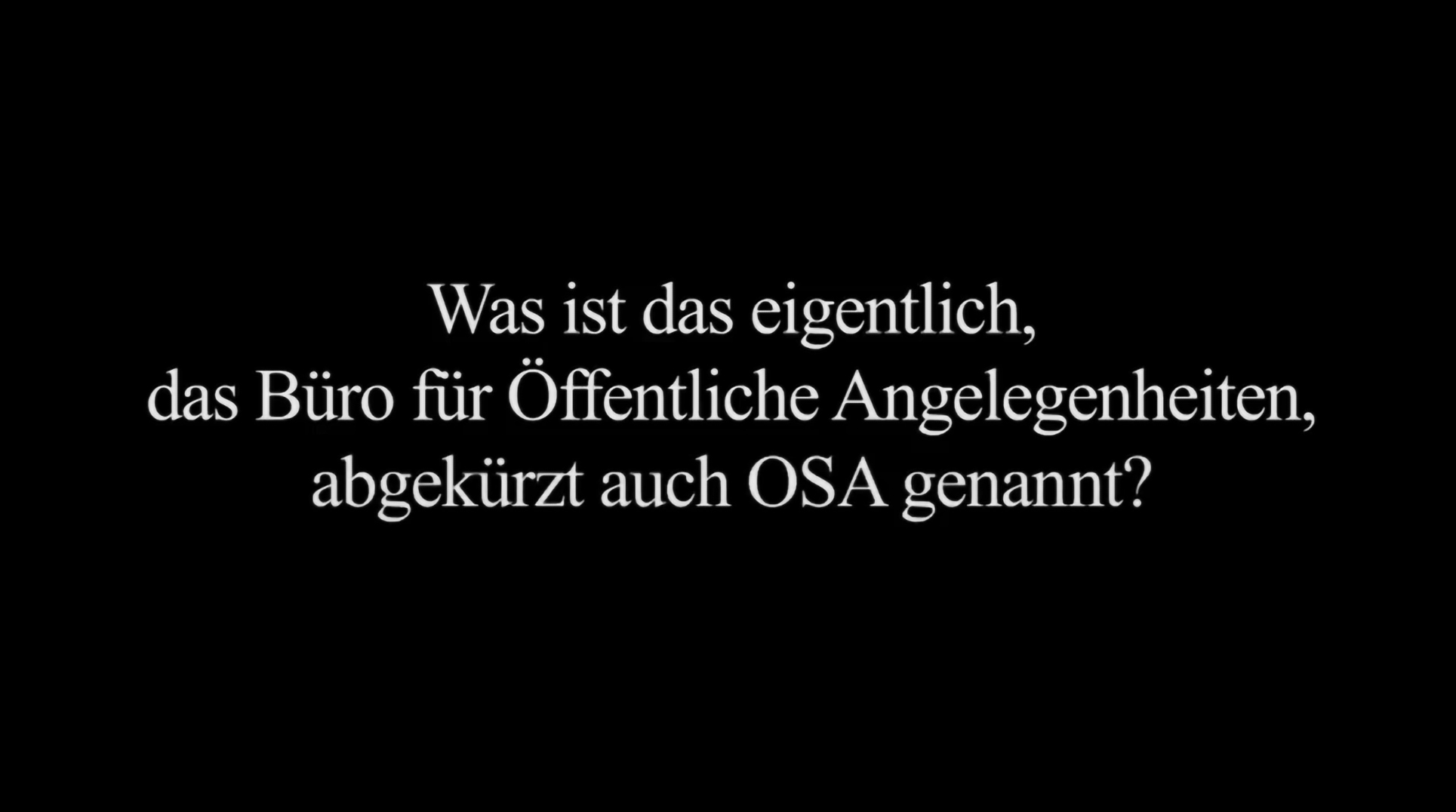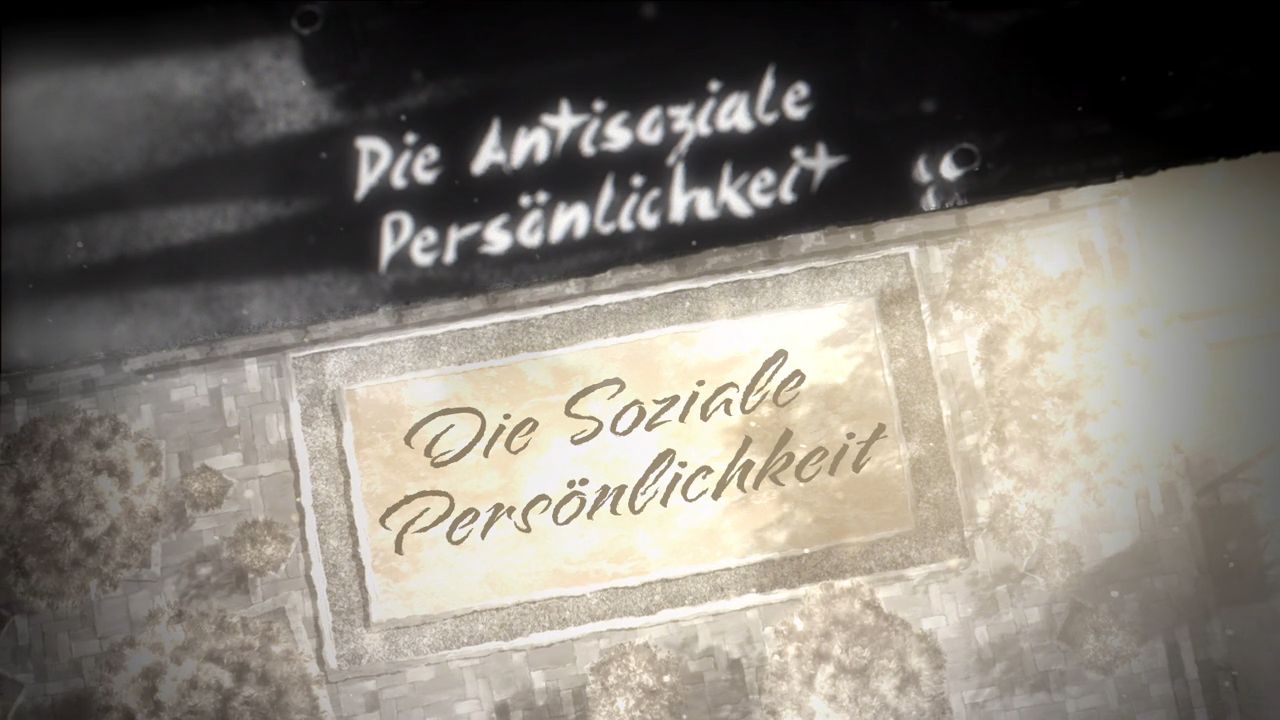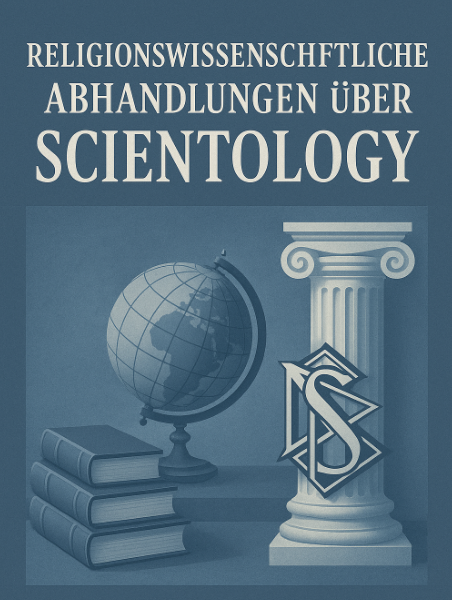Vor einigen Jahren sendete die ARD einen Film, der sich mit der Scientology-Organisation beschäftigte. Der Beitrag wurde von zahlreichen Zuschauern und Beobachtern als deutlich tendenziös und einseitig wahrgenommen. Kritiker warfen der ARD vor, die Darstellung von Scientology sei gezielt negativ gestaltet gewesen, mit verzerrten Darstellungen und fragwürdigen Behauptungen, die eher einer Kampagne als einer ausgewogenen journalistischen Aufarbeitung glichen.
Kurz nach der Ausstrahlung lud die ARD-Talkshow „Hart aber fair“ den damaligen Scientology-Pressesprecher Jürg Stettler ein. Viele Beobachter sahen darin eine inszenierte Konfrontation, bei der Stettler sich einer überwiegend kritischen Runde stellen musste. Ziel schien es zu sein, Scientology öffentlich in die Defensive zu bringen.
Entgegen dieser Erwartung gelang es Stettler jedoch, in der Sendung mehrere verbreitete Mythen und Fehlinformationen über Scientology zu hinterfragen und aus seiner Sicht richtigzustellen. Dadurch verlief die Diskussion nicht wie von der Redaktion offenbar geplant.
Interessanterweise zeigte sich nach der Sendung ein unerwarteter Effekt: Statt die Organisation weiter zu schwächen, stieg das öffentliche Interesse an Scientology deutlich an. Viele Zuschauer schienen das Vorgehen der ARD als übertrieben und manipulativ zu empfinden. Einige interpretierten dies als Beweis dafür, dass das Publikum zunehmend sensibel auf mediale Einflussnahme reagiert und sich lieber ein eigenes Urteil bildet – nach dem Motto: „Glaube nicht den Gerüchten, sondern informiere dich an der Quelle.“
Der Fall zeigt exemplarisch, wie schnell öffentlich-rechtliche Medien in den Verdacht geraten können, eine bestimmte Haltung oder Agenda zu verfolgen, wenn journalistische Distanz und Ausgewogenheit fehlen.